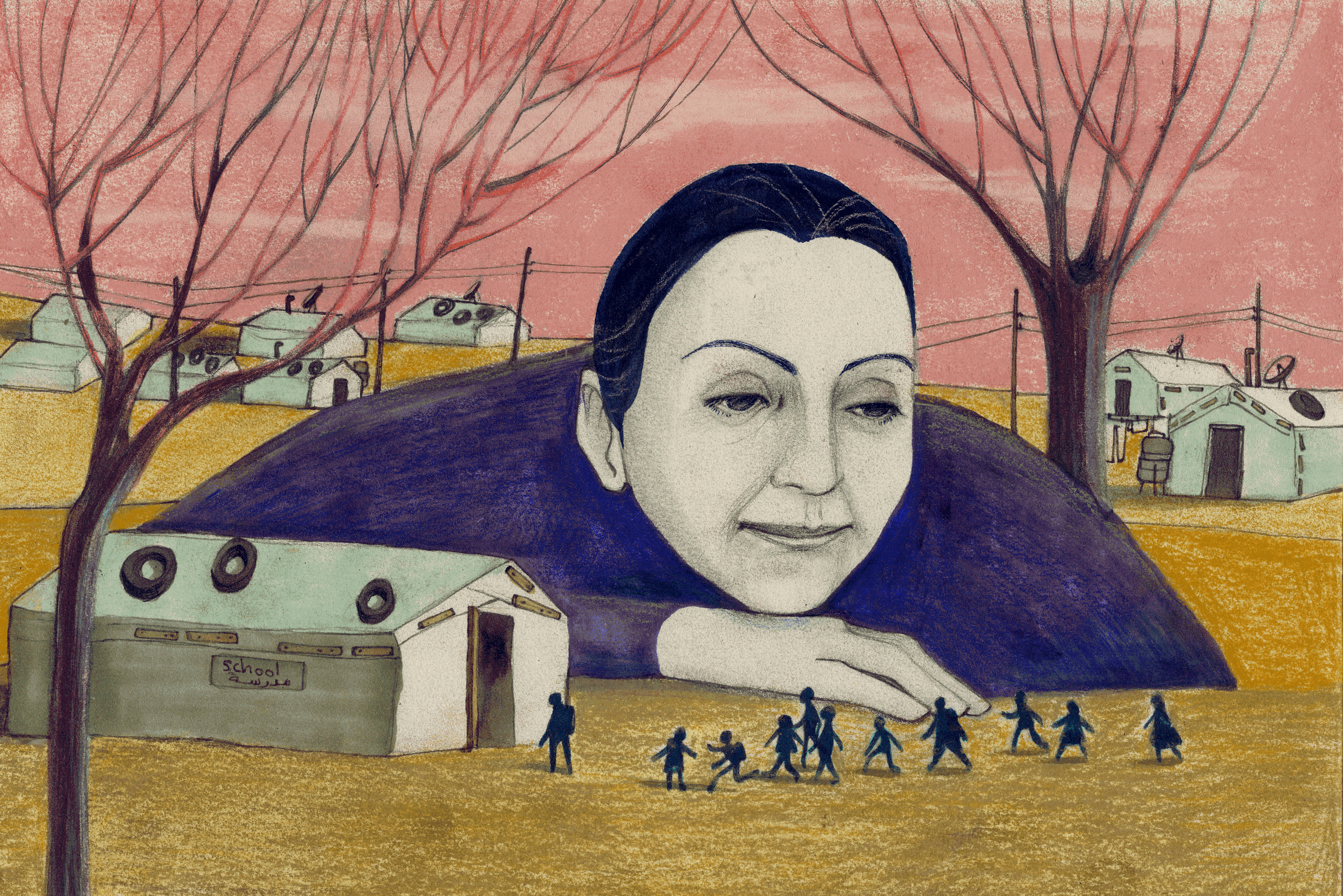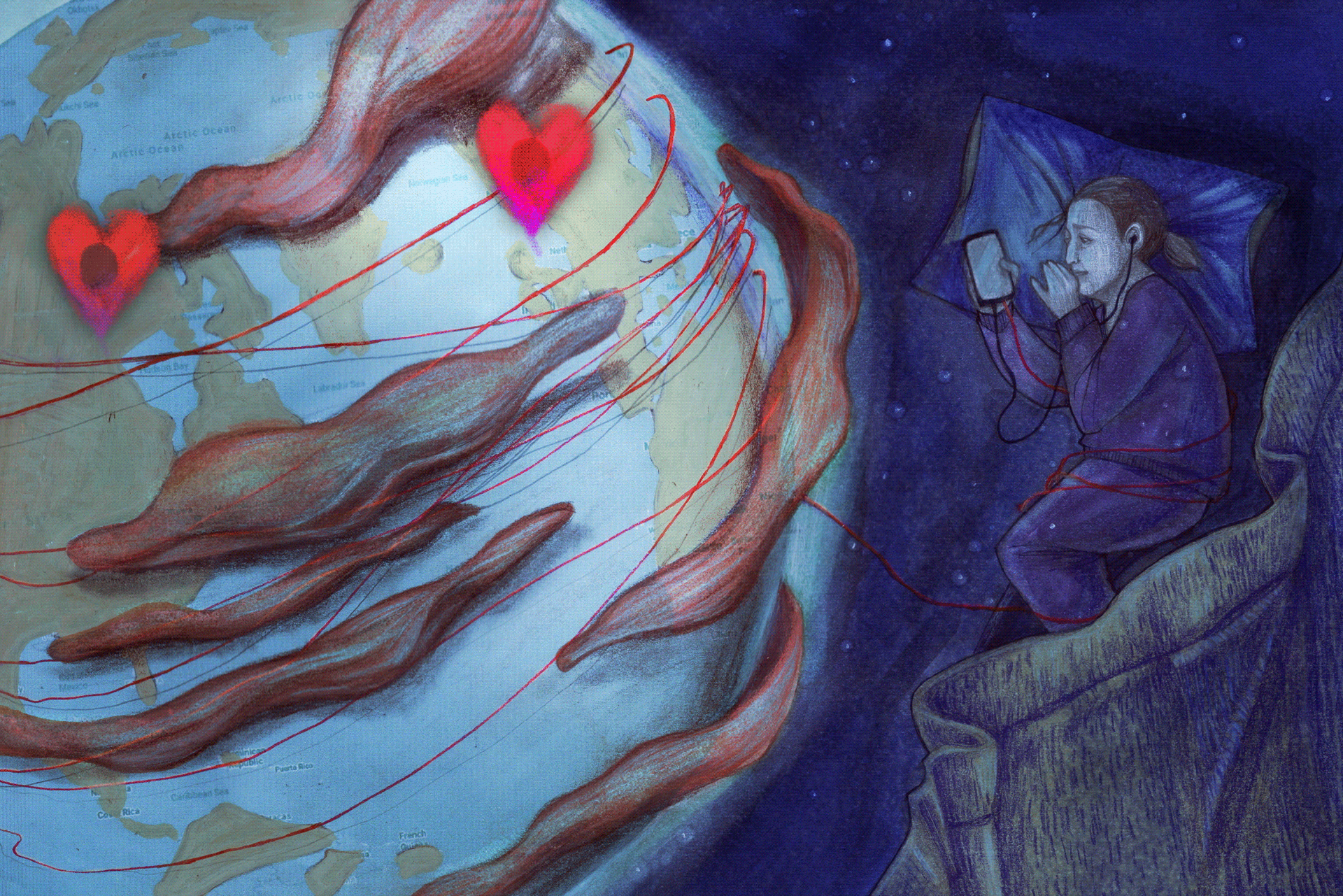Die Mutter des Aufstandes
Ola al-Jundi lächelt breit, wenn sie im Camp der Geflüchteten von „ihren“ Kindern umgeben ist. In der libanesischen Bekaa-Ebene betreibt die 48-jährige Gymnasiallehrerin eine Grundschule für geflüchtete Kinder aus Syrien. Das Klassenzimmer ist aus Brettern und Planen zusammengezimmert. Drinnen hängen selbstgemalte Bilder der Schüler*innen. In einem Video steht Ola al-Jundi glücklich vor einer Gruppe kleiner Mädchen, die sorgfältig gerichtete Zöpfe oder Pferdeschwänze tragen. Die Kinder haben einen Kreis geformt, klatschen in die Hände, stupsen sich gegenseitig an, sagen Sprüche auf, hopsen dabei hin und her. Sie spielen ein Spiel, das Erwachsene nie wirklich verstehen würden. Ola al-Jundi kann nicht anders und muss bei diesem Anblick einfach zuversichtlich sein.
Dabei ist al-Jundi ein zutiefst trauriger Mensch. Im Gespräch kommen ihr bei den Erinnerungen an den Beginn der syrischen Revolution im Jahr 2011 immer wieder die Tränen. Für sie fing alles in dem Dorf an, in dem sie geboren wurde und einen Großteil ihres Lebens verbracht hat. Es liegt unweit von Hama und heißt Salamiya. Der Ortsname kommt vom arabischen Wort Salam, das bedeutet Frieden.
Warum konnten die Syrer*innen nicht in Frieden ihre Freiheit erlangen? Das fragt sich Ola al-Jundi seit bald zehn Jahren pausenlos. Die Suche nach einer Antwort, das kann man jetzt schon sagen, wird ihr ganzes Leben bestimmen.
Unsere Revolution aber war von Anfang an größer als irgendwelche Glaubenskriege.
Ola al-Jundis Vater, ebenfalls Lehrer, war Mitglied in der oppositionellen kommunistischen Partei Syriens. In Salamiya unterstützten sich die Menschen schon immer bei der Bewältigung des Alltags gegenseitig. Als eines von acht Geschwistern hatte sich Ola al-Jundi früh vorgenommen, dass sie der Gemeinschaft etwas zurückgeben möchte. Die entscheidende Gelegenheit dafür ergab sich am 28. März 2011 direkt in ihrem Dorf. Die erste Demonstration gegen das Assad-Regime stand in der Region rund um Hama bevor. »Es war damals eine wahre Revolution. Denn das Regime versuchte, die Aufstände als ‚Sunniten gegen Schiiten‘ umzudeuten«, erinnert sich Ola al-Jundi. Ihre Familie selbst gehört – wie die meisten Bewohner*innen der Region – dem Ismailismus an, einer Glaubensgemeinschaft innerhalb des schiitischen Islams. Nach der Ideologie des Regimes dürfte so jemand wie Ola al-Jundi also nicht gegen den Clan von Baschar al-Assad, selbst schiitischer Alawit, demonstrieren. »Unsere Revolution aber war von Anfang an größer als irgendwelche Glaubenskriege«, sagt al-Jundi.
»Ich habe meine beiden kleinen Kinder mit auf die Demo genommen«, führt sie lachend fort. Aus heutiger Sicht eine riskante Entscheidung. Damals wussten sie aber nicht, wie weit das Regime gehen wird, um seine Macht zu sichern. Damals fühlte es sich richtig an, die Kinder auf die Demo mitzunehmen. Ola al-Jundi machte nie einen Hehl aus ihrer Opposition zum Assad-Clan. Mit den anderen Intellektuellen im Dorf – den Lehrer*innen, Ärzt*innen und Journalist*innen – erklärten sie den Menschen, warum es wichtig sei, nun für die eigenen Rechte einzustehen. Ola al-Jundi schätzt, dass ein Viertel der Dorfbewohner*innen sofort überzeugt waren.
Anders als in anderen Dörfern und Städten des Landes, schossen die syrischen Sicherheitsbehörden nicht auf die aufgebrachte Menge in Salamiya. »Sie warfen uns lediglich in Kerker.«
Ola al-Jundi landete in den ersten sechs Monaten mehrfach im Gefängnis, wurde zwischendurch mit einem Berufsverbot belegt. Siebzig junge Männer aus dem Dorf wurden in ein Geheimdienstgefängnis gebracht und gefoltert.
Allein weil sie bei einer Demonstration gegen das Regime mitmarschierten. Sie trugen Banner mit Forderungen, die jeden Diktator zur Weißglut bringen: Faire Wahlen, eine demokratische Verfassung, allgemeine Menschenrechte, Pressefreiheit, soziale Gerechtigkeit für Arbeiter*innen und Bauernbetriebe.
»Ich war für die Facebook-Einträge und für die Formulierung der Chor-Sprüche verantwortlich. Ich bin stets vorne neben den Bannern marschiert und habe die Gesänge angestimmt«, sagt Ola al-Jundi. »Es gibt nur ein syrisches Volk«, ruft sie rhythmisch ins Telefon. Das hört sich auf Arabisch imposanter an und für Syrer*innen war es durchaus wichtig, in ihrer höchst heterogenen Gesellschaft ihre Einheit zu betonen. »Am wichtigsten waren uns aber die Frauen«, sagt al-Jundi. Sie sollten zeigen, dass es sich um friedliche Demonstrationen handelt. Doch das Regime kümmerte sich nicht um solche Signale.
Gemeinsam organisierten sie eine Kinderbetreuung, sorgten dafür, dass stets eine Mutter aus jeder Großfamilie oder Nachbarschaft Zuhause bei den Kindern blieb. »Falls wir sterben oder eingesperrt werden, bleibt so immer jemand bei den Kindern. Unsere Männer wanderten ja alle nach und nach in die Folterkeller der Geheimdienste.« Es kam der Tag, an dem auch in Salamiya härter durchgegriffen wurde. Das Regime wollte unter allen Umständen erzwingen, dass die Frauen nicht mehr auf die Straße gehen. Denn ohne Frauen lässt sich das Bild der »Terroristen«, das das Assad-Regime bis heute von den damaligen, friedlichen Demonstrant*innen zeichnet, besser verkaufen: Es war, nicht nur rhetorisch betrachtet, die sorgfältig geplante Vorbereitung auf einen Krieg, der Hunderttausende Leben mit Fassbomben, Raketenhagel, orchestrierten Hungersnöten und Vertreibungen auslöscht.
Und es war ein tolles Gefühl! Zum erstem Mal dachte ich, dass ich ein Mensch bin. Je öfter ich gerufen habe, dass die Assads verschwinden sollen, desto mehr fühlte ich mich wie ein Subjekt. Das war so befreiend.
Als Ola al-Jundi Ende 2012 aus einer weiteren Haft entlassen wurde, merkte sie, dass sich etwas verändert hatte: Plötzlich mischten immer mehr Akteure in den Ereignissen in Syrien mit. »Aufgefallen ist mir, dass viele russische Medienberichte in meinem Facebook-Feed aufgetaucht sind. Alle behaupteten, dass unsere Revolution illegitim sei und beendet werden müsste.« Dennoch verspürte Ola al-Jundi weiterhin den Drang auf die Straße zu gehen. »Und es war ein tolles Gefühl! Zum erstem Mal dachte ich, dass ich ein Mensch bin. Je öfter ich gerufen habe, dass die Assads verschwinden sollen, desto mehr fühlte ich mich wie ein Subjekt. Das war so befreiend.«
Doch tatsächlich erschienen um sie herum immer weniger Frauen auf den Demos. Die Lage wurde von Tag zu Tag chaotischer und unübersichtlicher. Mal nahm die Polizei willkürlich Männer vom Straßenrand aus fest und warf sie auf LKW-Ladeflächen. Die Fahrzeuge fuhren weg, die Männer verschwanden. Mal attackierten Schergen des Regimes Menschen wahllos in ihren Häusern. Feuer brachen aus, Scharfschützen platzierten sich auf Dächern, Kampfjets flogen über ihre Köpfe.
Doch Ola al-Jundi hörte nicht auf, an die Utopie eines freien und friedlichen Syriens zu glauben. »Einige von meinen Schülern sagten mir, dass ich mich und meine Familie in Sicherheit bringen sollte.« Sie war ihren Schüler*innen, ihren Freund*innen, ihrer Familie zu mutig geworden im Angesicht der allmächtigen Diktatur. Nach einem Hinweis, dass sie selbst vom Regime entführt werden sollte, floh sie schließlich mit ihrer Familie in den Libanon.
Ich wollte meinen Kindern ein besseres Land schenken. Die Revolution sah ich im Jahr 2011 als ein Teil meiner Fürsorgepflicht an.
»Auch wenn es so schmerzvoll ist, erinnere ich mich doch sehr gerne an diese ersten Tage, Wochen und Monate unserer Revolution«, sagt al-Jundi heute. In ihren Erinnerungen mischen sich dennoch melancholische Töne, denn sie weiß, dass sie diese positiven Gefühle vielleicht niemals wieder verspüren wird. Die Utopie von damals ist eine Utopie in ihren Gedanken geblieben. »Ich wollte meinen Kindern ein besseres Land schenken. Die Revolution sah ich im Jahr 2011 als ein Teil meiner Fürsorgepflicht an«, sagt al-Jundi resigniert. Die Revolution sei einfach ein Teil ihrer Mutterschaft gewesen. »Syrische Mütter und ihre Superkräfte sollte man nie unterschätzen«, betont Ola al-Jundi und lacht.
Heute lebt sie weit weg von ihrem Sohn, der mittlerweile mit seinem Vater in Schweden wohnt und von ihrer Tochter, die in Kanada studiert. Das wiederum bedrücke sie sehr. Im Jahr 2018 kam aus Schweden ein Brief bei Ola al-Jundi im Libanon an. Sie könne zu ihrer Familie ziehen, wenn sie wolle. Die schwedischen Behörden haben einer Familienzusammenführung zugestimmt. 2018 war es aber zu spät, al-Jundi hatte schon seit vier Jahren die Verantwortung für Hunderte Kinder in ihrem Flüchtlingscamp übernommen. 2014 hatte sie 2000 Dollar von Bekannten zusammengekratzt, um das Schulgebäude zu errichten.
»Ich konnte sie nicht im Stich lassen und nach Europa gehen«, sagt sie mit Blick auf einen möglichen Umzug nach Schweden. Sie könne außerdem nicht von Syrien lassen. In Schweden wäre sie zu weit weg, dort wäre ihre Utopie mit Sicherheit längst verloren gegangen. Im Libanon, unweit von ihrer Heimat, könne sie sich noch irgendwie vorstellen, dass alles wieder gut werde. Im Redefluss bricht die Verbindung zu Ola al-Jundi ab. Der Strom in der libanesischen Bekaa-Ebene ist wie so oft ausgefallen. Es dauert einige Minuten bis das Internet dort wieder funktioniert. Als al-Jundi erneut anruft, sagt sie, dass sie sich manchmal schon Vorwürfe mache, ob das mit der Revolution richtig war. Sie sagt aber auch, dass sie und all die anderen Syrer*innen, die damals gegen das Regime in Salamiya und im ganzen Land friedlich demonstrierten, einfach keine andere Wahl hatten.